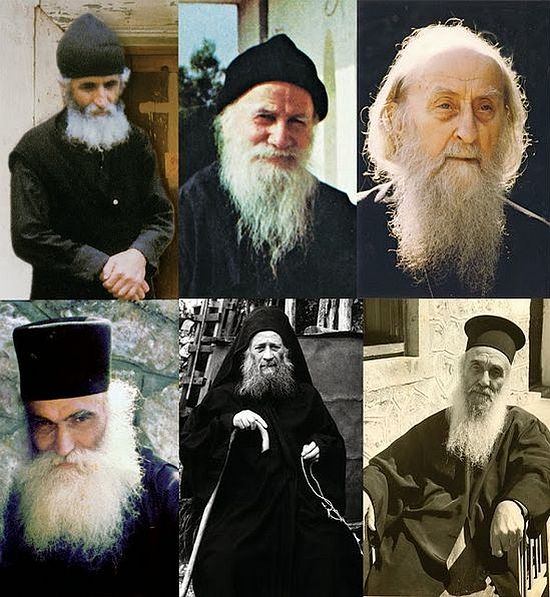|
| Hl. Benedikt (Montecassino). Bild: Wikimedia Commons / Annicari. |
Wie jeder weiß, empfing der hl. Benedikt, dessen Festtag anlässlich seines Heimgangs in die Himmelsglorie mit dem Vespergottesdienst beginnt, das Mönchsgewand vom hl. Romanus. Man wird nicht aus dem Nichts heraus Mönch, sondern empfängt sein monastisches Handwerkszeug aus den Hände eines Älteren, der als geistlicher Vater den Neuankömmling gleichsam auf seine Schultern nimmt. Der zukünftige Mönch lebt gewissermaßen aus dem Saft jener Wurzeln, die ihn mit dem lebendigen Wasser verbinden, das der Herr selbst gibt.
Dass das monastische Leben nicht immer eindeutig und geordnet "wie geschmiert" läuft, kann sich dann auch unverhofft zeigen:
Ein gewisser Mönch, der das sprichwörtliche mittlere Alter schon hinter sich gelassen und den sein Abt in der Profess just "Romanus" genannt hatte, lebt in einem Kloster der Provinz relativ zufrieden und rechtschaffen. Dieser P. Roman gehört zu denen, die nach dem Aufbruch der 68er Jahre und einem fundierten Theologiestudium in die geregelten Bahnen von charismatischen Konservativen zurückgefunden haben. Seit Jahren kümmert er sich aufopfernd um die Bedürftigen und Verzweifelten, die in sein Kloster kommen, um dort aufzutanken oder einfach nur Hilfe zu erbitten. Tatsächlich leistet man dort echte christliche und großartige Arbeit - das zu wissen, ist wichtig, um den Fortgang der Geschichte richtig zu verstehen. P. Roman also ist eines Morgens nach den geistlichen Verrichtungen wie gewohnt vom Wohntrakt in sein Büro unterwegs, wo er allfälligen Schriftverkehr zu erledigen hat oder für Besucher erreichbar ist. Sonderbarerweise will ihm die Beantwortung der Briefe nicht gelingen und selbst nach einer Stunde verbissener Arbeit hat kein Anruf ihn ins Sprechzimmer zu einem Kranken oder Traurigen beordert. Es gibt diese Tage, an denen man nicht warm wird und eine leichte Verstimmung über sich selbst um sich greift. Deshalb steht P. Roman kurzerhand vom Schreibtisch auf, läßt die Tür dezent krachend und mit einem verschmitzten Lächeln (ob dieser Derbheit) ins Schloss fallen und geht ins benachbarte Städtchen hinunter, in dem er (zurecht) wohlgelitten ist. Aber immer noch nagt irgendetwas in ihm - bis er über einen Mann stolpert, der weder erlesen noch geschmacklos gekleidet ist und auf ihn zu warten scheint. P. Roman gehört zu den Menschen, die sofort den richtigen Draht zu ihrem Gegenüber finden. Deshalb hält man sich nicht lange mit Förmlichkeiten auf, sondern kommt direkt zur Sache: Jener Mann, der sich als Tim vorstellt, führt P. Roman in eine der Altstadtgassen und bleibt schließlich vor einem stattlichen, frisch renovierten Haus stehen. Ohne anzuschellen, öffnet er die Haustür und geht ins 2. Obergeschoss. P. Roman ist ein feinfühliger Mensch und merkt schnell, dass hier seine Anwesenheit gebraucht wird. Sein Begleiter Tim hat die Schlüssel zur Wohnung schon parat und schließt gerade die Tür auf, als P. Roman im etwas verschmitzt lächelnden Gesicht seines kurzzeitigen Weggefährten irgendeinen altbekannten Zug entdeckt, der ihn stutzig innehalten läßt. Tim schert sich nicht darum, sondern befördert P. Roman mit einem strahlenden Lächeln und einem nicht weniger ausstrahlenden Stoß in den Rücken in die Wohnung.
P. Roman erwartet hier keiner seiner geistliche Unterstützung suchenden Bekannten oder einer der vielen ratsuchenden Unbekannten. Er findet sich wieder in einer Art sauberem Flur mit hübschen Türen zu beiden Seiten. Ihm wird unbehaglich zumute, doch Tim führt in gnadenlos freundlich zur ersten Tür, die nach zaghaftem Anklopfen geöffnet wird. P. Roman steht vor einem seiner betagten Mitbrüder, der, als hochdekorierter Neutestamentler längst emeritiert, nunmehr für jeden in der Gemeinschaft ein offenes Ohr hat. Verdutzt beschleicht P. Roman das unangenehme Gefühl, dass Tims Ausflug mit ihm kein Zufall ist. Und beschämt sieht er im Lächeln seines Mitbruders, der ihn freundlich anblickt, die Qual der Einsamkeit. Und noch beschämter merkt er, dass ihm selbst das Herz schwer wird, als Tim ihn bei der Hand nimmt und zur nächsten Tür führt. Auch die wird geöffnet (allerdings ungestümer, als erwartet), und P. Roman blickt ins Gesicht eines der jungen Professmönche, den sie aus der Philosophiegeschichte aufgeschreckt haben. Das gleiche Unbehagen steigt in P. Roman auf, als Tim dem jungen Nachwuchsphilosophen die Hand auf die Schulter legt und P. Roman gleich darauf ansieht: Es braucht mehr als nur die höfliche und "regulare" Freundlichkeit unter Mitbrüdern, um zur Gemeinschaft zu werden, die dem hl. Benedikt wohl vorschwebt! Es braucht vor allem ungeteilte und echte Zuwendung, die mehr Zeit verschlingen kann, als alle harte Arbeit im herkömmlichen Weinberg des Herrn. P. Roman versteht und läßt sich nur widerwillig von Tim zur dritten Tür ziehen. Der klopft leise an und muß die Tür selbst öffnen, da der Bewohner kränklich ist - und schläft. Oft hat P. Roman geholfen, wenn die Kranken seiner Gemeinschaft zu versorgen waren. Trotz anderer Aufgaben war er immer ansprechbar, wenn jemand von den Krankenpflegern Hilfe brauchte. Trotzdem liest er in dem gutgelaunten Gesicht seines unbekannten Führers eine andere Realität, die sich ihm bisher - gut weggeschlossen - entzogen hatte. Er geht zu seinem schlafenden Mitbruder und ist auf einmal ebenfalls müde und erschöpft. Ihm fällt auf, wie wenig er gelernt hatte, als ihm die Parolen der geschwisterlichen Kirche um die Ohren geschlagen wurden. Er hatte sie richtig eingeordnet und versucht, das Evangelium tatsächlich zu leben. Aber er hatte den zweiten Schritt vor dem ersten getan. P. Roman hatte dort hart und gut gearbeitet, wo seine Zuwendung zu offensichtlich gebraucht wurde. Der intellektuelle Blick des Theologen P. Roman hatte versagt, als es um seine nächsten Nächsten ging: Die kommen nicht an die Klosterpforte, sondern versuchen sich in seine Agenda zu stehlen, indem sie ihn nach der Terz (vergeblich) im Kreuzgang abfangen möchten. Oder sie sehen nach dem Abendessen sein erschöpftes Gesicht und bringen nur Oberflächlichkeiten heraus, obwohl ihnen - seinen Mitbüdern - Wichtiges auf der Seele brennt.
- Irgendwann merkt P. Roman, dass er bei einer (leeren) Espressotasse vor dem Stadtcafé eingenickt ist. Die Rechnung ist bezahlt, wie er sieht, und Tim hat ihm zum Abschied eine mehr oder weniger gelungene Weltkugel auf die Rechnung gekritzelt. P. Romanus versteht das übrigens sofort: "Die göttliche Kraft war dem hl. Benedikt mit solcher Gnadenfülle geschenkt worden, dass er wie in einem einzigen Strahl der Sonne die gesamte Welt in ihrer Fülle erblickte." (Non-Antiphon am Festtag des Transitus s. Benedicti) Gerade eben hat P. Roman in einem Funken dieses Lichts sehen dürfen, was sich dem hl. Vater Benedikt als "omnem mundum collectum" - als "der ganze Erdkreis zusammengebündelt" in einer anderen Dimension offenbart hatte: den kleinen Kosmos seiner eigenen Klostergemeinde, in dem die Hungrigen, Durstigen, Gefangenen, Traurigen auch auf ihn warten. Der hl. Benedikt hat diese Erkenntnis in seinem 4. Regelkapitel festgehalten, wo es um die Werkzeuge der geistlichen Kunst geht. Dessen letzter Satz lautet schlicht:
"Die Werkstatt aber, in
der wir [diese Werkzeuge] sorgfältig [gebrauchen] sollen, ist der Bereich des Klosters und die
Beständigkeit in der Gemeinschaft." (vgl. RB, Kap. 4,78).