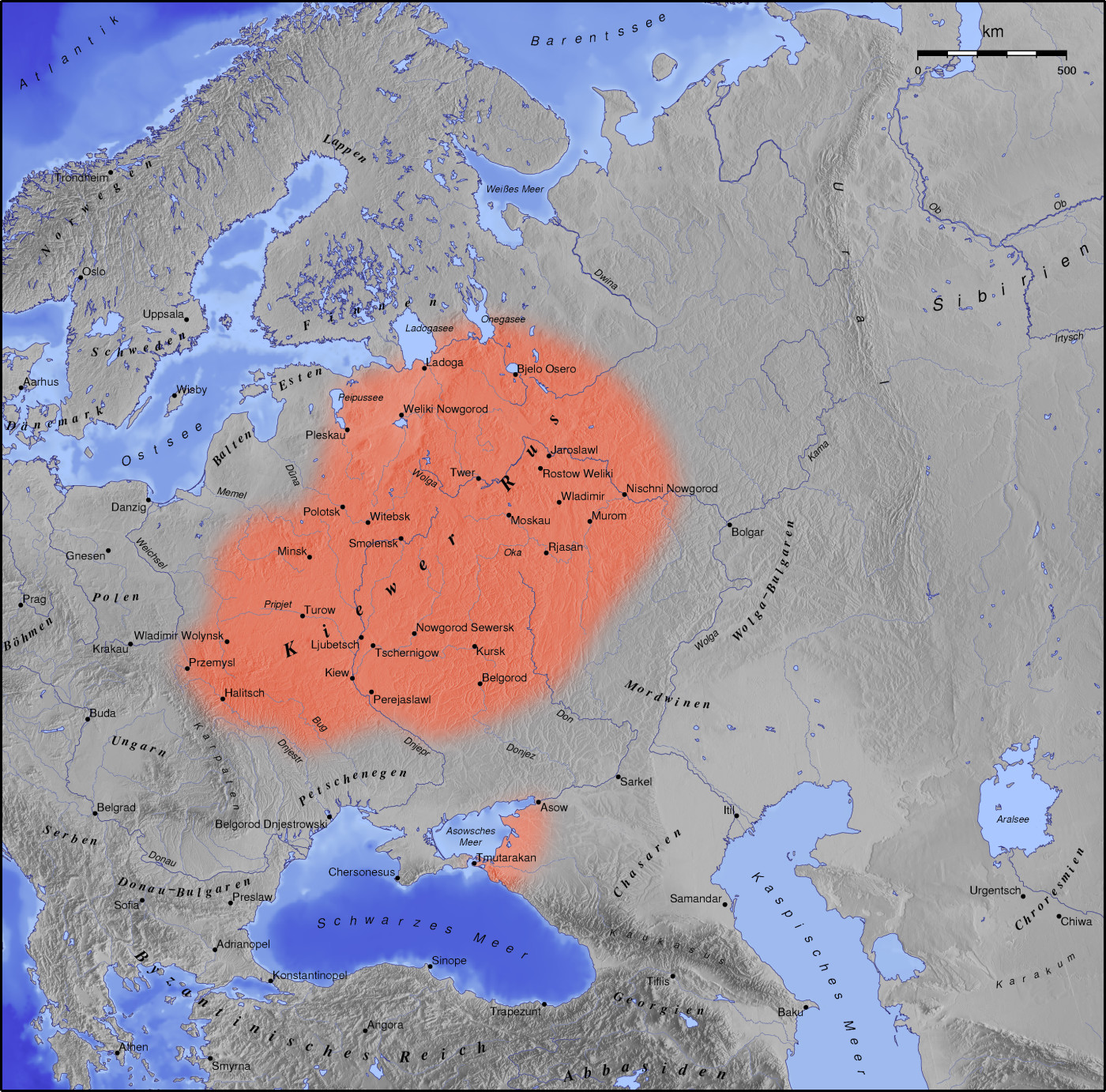vor 5 Jahren
Posts mit dem Label Kirchenpolitik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Posts mit dem Label Kirchenpolitik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen
Freitag, 25. Februar 2022
Die Ukraine - ein geschundenes Land
Aufrufe über Aufrufe: Frieden für die Ukraine... So berechtigt diese Aufrufe sind: Wehe der Ukraine, wenn alles wieder so werden soll, wie es war! Die heutige Ukraine hat als Identifikation nicht etwa den Blick auf ein gemeinsames Volk, auch nicht auf eine gemeinsame Religion. Die Ukraine mit ihren politischen und teilweise auch kirchlichen Vertretern bauen auf die Macht und die Kraft des Hasses gegen Russland, gegen alles, was russisch ist und klingt. Gnade uns Gott, wenn das die Fundamente des ukrainischen Staats sein sollen, ja womöglich wieder werden sollen, wenn Russland beseitigt ist. Welche Perspektive für ein Land, dessen Territorium seit Jahrhunderten ein Spielball der polotischen Mächte war. Gott möge den Menschen in der Ukraine beistehen, wenn sich durchsetzen kann, was selbst kirchliche Vertreter wie Epifanij Dumenko sich wünschen: Friede durch Vernichtung und Hass! Es ist höchst fragwürdig, was in der Presse, auch in der kirchlichen, auch in der politisch gemäßigten, als Motivation Russlands und der russischen Kirche vermutet wird. Patriarch Kyrill wird "Selbstschutz" vorgehalten, wenn er sich als "willenloser Untergebener des Kreml" nicht für eine Ukraine einsetzen möchte, die sich weiterhin durch Unterdrückung und Hass definiert auf Kosten der vielen Menschen, die es verdient haben, in Frieden und Freiheit zu leben. Frieden und Freiheit gab es in all den Jahren nicht, da die Regierung der Ukraine als Marionette der westlichen Mächte alles tun durfte - nur eines nicht: dem vermeintlichen Gegner Russland die Hand reichen, zur Überwindung der geschichtlich gewachsenen, aber durch abgrundtiefen Widerwillen gegen alles Russische angefeuerten Ressentiments arbeiten, das freie, auch anti-westliche Wort gestatten! Die Ukraine hätte alles gewonnen, wenn man dort an den Schalthebeln der Macht, die doch nur von den wirklichen Machthabern außerhalb des Landes umgelegt werden, zumindest den Menschen des Volkes hätte dienen wollen, nicht dem, was als erstrebenswert und paradiesisch angepriesen wird, wo es doch in Wirklichkeit nur vergammelte, verrostete Schätze sind, mit denen keiner mehr etwas anzufangen weiß. Man hört die Aufrufe zum Frieden in der Ukraine! - Lassen wir auch Taten folgen, auf dass nicht der Hass, sondern die Liebe zur Grundlage des Friedens wird.
Labels:
Kirchenpolitik,
Politik,
Russland,
Ukraine
Samstag, 12. Februar 2022
Das maskierte Schisma
Zuerst eine kleine, nicht vollständige Auflistung einiger Artikel zum Thema Schisma und Zerrüttung in den orthodoxen Patriarchaten (dem ökumenischen, von Moskau, von Alexandrien):
- Facebook-Eintrag von Orthodoxie aktuell
- Meldung auf Orthodox Christianity
- Motivation des russ. Eindringens in das Territorium des Patr. von Alexandrien
u. s. w., denn es gäbe noch zahlreiche Veröffentlichungen, die sich in den unterschiedlichen Sprachen zu diesem thema äußern; dazu kommen die Diskussionen zu diesen jeweiligen Beiträgen.
Auffallend ist indes, dass es wie eine "Sprachverwirrung" vorkommen muss, wenn sich die Parteiungen gegenseitig des Unrechts und der Missachtung von Gesetzen und Kanones bezichtigen. Das Schisma zwischen den Patriarchaten ist nicht da, weil Moskau auf seiner Position beharrt, weil der Phanar unrechtmäßig Moskauer Rechte beschnitten hat oder weil Moskau auf fremdes kirchliches Territorium übergreift.
Das Schisma existiert vor allem deshalb, weil die Kirche nicht auf Hass, nicht auf völkische Argumentationen, nicht auf Grenzverschiebung und politische Machtverhältnisse gründen kann, die heute so, morgen anders liegen werden. Das Schisma ist da, weil die sogenannte "Orthodoxe Kirche der Ukraine" ihre Existenz dem Hass und der Ablehnung alles "Russischen" verdankt. Dadurch war die Versöhnung der bis 2018 von der orthodoxen Kirche getrennten Menschen - praktisch aller Hierarchen, Kleriker etc. dieser Neuschöpfung des Phanar - einfach nicht möglich, da sie nicht gewollt war. Als Verwaltungsakt könnte sie - wer weiß das? - stattgefunden haben, doch das hat nichts mit dem zu tun, was Christus und was das Beispiel der Apostel der Kirche aufgetragen hat. Es ist eine abgrundtiefe Wunde: Wer unversöhnt und sogar verfälschend eine Kirchenstruktur errichten will, kann nur eine Nicht-Kirche hervorbringen, denn es fehlt das Wesentliche: die versöhnte Communio.
Diese mangelnde Fundamentierung wird im Phanar seit hundert Jahren durch "Rechtsakte" übertüncht, die im Grunde völlig widersinnig erscheinen: Am Beispiel der Gebiete von Finnland, Estland, jetzt der Ukraine lässt sich eine fatale Haltlosigkeit politischer Machtspiele aufzeigen. In Finnland war die Communio jahrzehntelang zerstört, die Menschen blieben zerstritten, die Mysterien waren nicht Zeichen der Gemeinschaft, sondern Zeichen der Trennung. Erst als das Leid zu groß wurde, als die Versöhnung nicht mehr per Aktennotiz vergegaukelt werden konnte, sondern mit Leben erfüllt werden musste, konnte die orthodoxe Kirche in Finnland Wirklichkeit werden. Das Beispiel Estland ist ähnlich zu bewerten: Was ist das für eine "Kirche", die sich gründet auf das Anti-Russische, so verständlich es vielleicht erscheinen könnte nach den Ereignissen der Okkupation etc. Ohne Versöhnung fehlt die Communio, fehlt im Grunde der "rechte Glaube", die Orthodoxie. Es braucht vieles nicht in der Kirche: der Mensch bleibt Sünder, er bleibt fehlerbehaftet, subjektiv und engstirnig. Was es allerdings braucht in der Kirche ist der Wille, in der Gemeinschaft der Kirche zu leben. Diese Kirche umfasst zwingend alle, die die Mysterien empfangen und als Christen leben wollen. Deshalb gibt es keine "Versöhnung zu Sonderkonditionen", die nur die einschließt, die mir genehm sind oder die mir ersparen könnte, die Versöhnung persönlich anzubieten. Fehlt diese Versöhnung, wird die Kirche ausgeschlossen, obwohl das Dekor scheinbar stimmt. Deshalb die nachgeholte Weihe von Männern, die aus dem Schisma in die Kirche zurückkehren, deshalb aber auch die Praxis, die Weihen von römisch-katholischen Klerikern anzuerkennen (nach dem Brauch des Moskauer Patriarchats): Eine Unversöhntheit (im oben dargelegten Sinne) ist bei diesen röm.-kath. Weihevorgängen nicht anzunehmen und die Aufnahme in die orthodoxe Kirche stellt eben keinen Verwaltungsakt dar, sondern eine tiefgehende, von Gott charismatisch bewirkte Heilung.
Unverständlicherweise tritt das Schisma zwischen dem Phanar, Moskau, Alexandrien, Jerusalem und Antiochien völlig in den Hintergrund, während die Folgen der schismatischen Situation in aller Munde sind. Lösungen lassen sich so freilich nicht finden. Denn die Problematik wir augenscheinlich, z. B. in den verlinkten Artikeln, überhaupt nicht benannt. Wer aneinander vorbeiredet, kann sich nicht wirklich verstehen.
Dienstag, 25. Januar 2022
Vom Wert der Unergründlichkeit
Scheinbar hilft es enorm, Gedanken eine feste Form zu geben. Ob Journalisten das ebenfalls so wahrnehmen, sei dahingestellt. Was dem Menschen oftmals zugemutet wird an Veröffentlichungen, übersteigt hingegen das Maß des Erträglichen. Auf jeder neuen Seite im Internet lassen sich die Anklagen und Weh-Rufe verfolgen, die geschickt und höchst manipulativ mit Wörtern jonglieren und sich die Angst und die Unsicherheit der Menschen zunutze machen. Bei genauerer Analyse entpuppt sich das Allermeiste als wenig fundierter Abklatsch einer Modemeinung, die heute so, morgen anders hofiert wird. In einem interessanten Aufsatz zur Rezeption der Liturgiehistorie (Alain Rauwel, Les espaces de la liturgie au Moyen Âge latin) beleuchtet der Verfasser den Umgang der Geschichtswissenschaft mit liturgiehistorischen Quellen und denkt laut nach über die Rezeption dieser Quellen in wissenschaftlichen Kreisen heute: Ohne wirklich zu tragfähigen Definitionen der Begrifflichkeiten gelangt zu sein, wirft man eifrig mit eben diesen Begrifflichkeiten um sich. Eine der fatalsten Folgen ist die völlige Verzerrung der Quelle durch unsachgemäße Übertragung des Originaltextes bei seiner Exegese. Beispiele gibt es zu Genüge. Daher sei an dieser Stelle auf zwei der bedenklichsten Fehlgriffe hingewiesen - wohlwissend, dass sicher keiner der "Exegeten" vorsätzlich falsch interpretieren will, zumal es sich sehr oft um wirklich verdienstvolle und hochgebildete Wissenschaftler handelt!
Bei der ersten Missdeutung geht es um die Übertragung eines fremdsprachlichen Begriffs - vor dem hier behandelten Hintergrund ist es meist eine Übersetzung aus dem Lateinischen: Tatsächlich trifft dann auch voll und ganz zu, was Rauwel beklagt, dass nämlich das lateinische Wort für sich genommen richtig übersetzt wurde, dass die Übersetzung im Kontext allerdings völlig falsch gewählt wurde. Nicht nur das: Jeder Lateinschüler kann im Wörterbuch nachschlagen, dass z.B. der Ausdruck "venia" bedeuten kann: Gefälligkeit, Gunst, Gnade, Nachsicht, Erlaubnis, Verzeihung, Vergebung, Straflosigkeit... Leider kann ein solches Wörterbuch allgemeiner Art nicht Bildung im guten Sinne ersetzen; um "venia" halbwegs gut übertragen zu können, muss der Leser den Begriff einzuordnen verstehen in seinen konkreten Kontext. Er muss sich ein Verständnis von dem gebildet haben, was der Text weitergeben möchte. Ein solches Verständnis kann heute unser Vermögen übersteigen! Das angemessene Verständnis des Wortes "venia" (auf konkrete Passagen bezogen) ergibt sich aus einer Zusammenschau der persönlichen Haltung, der geistlichen Überzeugung und vor allem des konkreten Tuns eines Menschen, dem sich die "venia" anbietet als äußerer Ausdruck seiner Teilhabe am Leben der Kirche: Er vollzieht eine Venia.
Wir gehen indes mit dem Handwerkszeug an diese Arbeit heran, das uns erreichbar ist, und das ist oftmals sehr hochwertig; aber es ist modern, will heißen: Wir versuchen, etwas auseinanderzunehmen, indem wir dort Verbindungen - notfalls mit Gewalt - mittels Schraubendreher und Schraubenschlüssel lösen wollen, wo es weder Schraubenkopf noch Mutter gibt. Alain Rauwel plädiert dafür, zuerst zu ergründen, wie unser Werkstück - der historische Text - zusammengefügt ist, um schließlich ans Ziel zu gelangen, ohne ein völlig zerstörtes und damit auch nutzlos gewordenes Artefakt präsentieren zu müssen. Es entspricht dann in Form und Gestalt dem, was wir kennen, hat aber nichts mehr mit dem zu tun, was es war und sein sollte.
Eine zweite Missdeutung stellt sich unweigerlich ein, wenn nicht nur der Begriff falsch übersetzt wurde, sondern auch der Kontext verkannt wird. Wie ist der Text zu lesen, wenn er sich mir so erschließen soll, wie es beim historischen Adressaten der Fall war? Diese Fragestellung lässt die erschwerten Umstände einer adäquaten Interpretation eines historischen Textes deutlich werden. Wenn wir heute allerdings wirklich versuchen möchten, aus der Geschichte zu lernen, Gebildete zu sein, dann müssen wir uns auf den Weg machen und uns wenigstens in einer Antwort auf die gestellte Frage versuchen!
Keinesfalls sollten wir dann so vorgehen, wie es aus sehr vielen Kanälen auf unsere Bildschirme schwappt: voreingenommen, geschichtsvergessen, opportunistisch, auf einem Auge (oder gar auf beiden) blind, unbelehrbar, hasserfüllt, unversöhnlich...
Die gründliche und unvoreingenommene Erforschung der kirchengeschichtlichen Quellen, gerade auch der liturgiehistorisch relevanten, kann Antworten geben auf die meisten der heute diskutierten Fragen und Probleme, in der orthodoxen Kirche, aber auch in der römisch-katholischen, ja sogar im Protestantismus. Es scheint so, als hätte nur selten einer die Möglichkeit, so zu forschen. Was mancherorts zu lesen ist, trägt dann leider oft die allzu deutlichen Spuren fehlender Objektivität. Das ist verständlich, sogar verzeihlich, aber nicht wirklich hilfreich. Die Antwort, eigentlich so nah, zieht sich dann wieder zurück. Sie hat nichts gemein mit simplen Notlösungen, noch viel weniger hingegen mit Verdrehung, Mißbrauch und Opportunismus.
Dienstag, 12. Januar 2021
Die Macht des Wortes - verantwortungsvoller Journalismus
Gerade jetzt im neuen Jahr muss es sauer aufstoßen, wenn eine Zeitung wie "Die Tagespost" sich zum Sprachrohr der Parteiungen macht. Auffällig ist freilich nicht nur die Parteinahme der "Tagespost" für Strömungen innerhalb der Orthodoxie, die nicht so einfach abzuhandeln sind, wie es den Redakteuren erscheinen mag. In einem jüngst erschienenen Artikel beklagt Stephan Baier die Diskreditierung des Moskauer Patriarchats in Hinblick auf die Hilfe für verfolgte afrikanische Christen. Diese Diskreditierung sei Folge der kirchenpolitischen Ambitionen des Moskauer Patriarchats, seiner Eigeninteressen. Leider unterschlägt der Autor manche Details: Er erwähnt nicht die Positionierungen der Moskauer Bischofssynode zugunsten des "Ökumenischen Patriarchats" und seiner Bedeutung, er erwähnt nicht die bei weitem komplexere Binnensituation der orthodoxen Ortskirchen - Jerusalem mit ihrer Vermittlerrolle, die anderen Patriarchate in ihrer Stellung im politischen Gefüge - und sieht folglich nur die vermeintlichen russischen Angriffe auf die Aggressoren der russischen Kirche: den Phanar, dem seine Protos-Rechte streitig gemacht würden, den Patriarchen von Alexandrien, der zum "Phanar" hält und dem deshalb "Moskau" eine Hundertschaft Priester abspenstig machen will. S. Baier verkennt scheinbar völlig die strukturelle Schwachstelle seines Argumentationsgefüges: Die "Orthodoxie" sieht sich nicht zuerst als Größe, die es zu verteidigen gilt, sondern sie sieht sich vor allem als Kirche, die im apostolischen Glauben leben möchte. Obwohl sicherlich auch Machtgefüge und Einfluss nicht auszuklammern sind, verbietet sich doch eine einseitige Argumentation, wie sie S. Baier zum wiederholten Male vorträgt und für die er sich zum Sprachrohr macht. Orthodoxerseits findet tatsächlich ein Kampf statt: es ist der um die Orthopraxie, das rechte Handelns. Nicht umsonst hat das Außenamt des Moskauer Patriarchats betont, dass eine Übernahme von Priestern des Patriarchats von Alexandrien zuerst einmal nicht wünschenswert ist, da sie zu einem anderen Patriarchat gehören. Legitim wäre ein solche Übernahme erst dann, so ist zu folgern, wenn das Wohl der Gläubigen auf dem Spiel steht. Denn es ist die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen, um die es geht, es sind nicht Landesgrenzen oder Macht und Einfluss - was immer menschliche Unvollkommenheit auch durch die Hintertür einzubringen vermag (und was nicht abgestritten werden soll).
Daher wäre es wichtig und wünschenswert, wenn auch im Journalismus die Macht des Wortes gebührend Beachtung fände. Es brauchte keine Lobhuddelei auf wen auch immer sein, aber eine einigermaßen ausgewogene Berichterstattung verdient auch jemand, dem ich nicht meine Sympathie entgegenbringe.
Abonnieren
Posts (Atom)