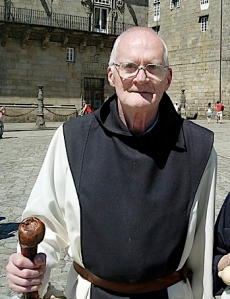Das erklärte Ziel der Liturgiereform in der römischen Kirche nach dem 2. Vatikanischen Konzil war die tätige Mitfeier der Liturgie von Gemeinde und vom Volk Gottes, wie man gern sagte. Wurde das Ziel wirklich geradlinig ins Auge gefasst? Mir kommen Zweifel, wenn ich die Praxis sehe.
Abgesehen von den alltäglichen Unsäglichkeiten der "actuosa participatio", die in Form einer aktiven Teilnahme oft immer noch eingefordert wird, bleibt manchmal kein Auge trocken, wenn die "Aktivität" realiter ins Blickfeld rückt. "Purer Klerikozentrismus" fällt mir dann ein. Eine Errungenschaft der römischen Liturgiereform schien der Abschied vom Rubrizismus zu sein. Der ist freilich tatsächlich neueren Datums, kann sich nicht auf Phrasen stützen wie "Liturgie aller Zeiten" u.ä.M.(m.). Unsere Zisterzienserliturgie, die als solche ihre Zeugen hat in der Literatur der ersten Jahrhunderte der zisterziensischen Ordensgeschichte (Caesarius von Heisterbach z.B.), sie kennt den schönen Brauch der Darbringung der Kerzen an Mariae Reinigung / Lichtmess. Und was für ein Bild bietet sich heute oft? Die Zurüstung des Altars - ein Ritus, den der Priester als Beauftragter der Kirche, legitimiert durch die anwesende Gemeinde (!) vollzieht - sie geschieht unter dem hockenden Blick der Gemeinde, die sitzt und hoffentlich das Geheimnis betrachtet, das vollzogen wird. Wo ist hier die Liturgiehistorie? Unterstützt die Gemiende auf solche Art ihren Beauftragten, indem sie sich bei dieser heiligen Handlung hinsetzt, als wäre sie nicht beteiligt, als würde ein purer Veraltungsakt getätigt? Und am Festtag der Reinigung Mariens kommt der schöne Ritus der Opferung der Kerzen hinzu. Hier wird die Gemeinde noch mehr geadelt, als sie es sonst eigentlich schon ist. Sie darf nicht nur die "Benedicta", die heiligen Gaben von Brot und Wein, darbringen, sondern auch die geweihten und brennenden Kerzen, mit denen sie eben zur Liturgie gezogen ist. Überholt? Zu aufwendig? Veraltet? Gar: Demütigend?? Das Gebet zur Benediktion der Kerzen schließt mit dem Blick auf den Bräutigam, Christus, dem wir mit brennenden Herzen entgegengehen wollen. War das eine überholte Liturgie?